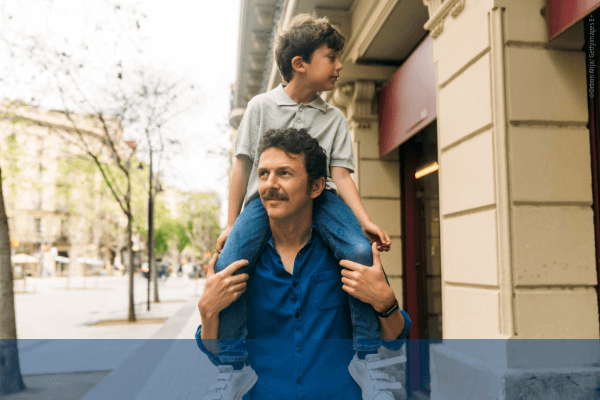Ich weiß nicht genau, warum, aber der Anblick von Eltern, die ein Kind auf den Schultern tragen, hat immer schon mein Herz erwärmt, und ich erinnere mich noch gerne an die Zeit zurück, als ich dies mit meinen getan habe. Etwas – oder jemanden – zu tragen, von einem Ort zum anderen, ist eine der urmenschlichsten Tätigkeiten, auch noch in Zeiten von Rollkoffern und Lieferservice. Manchmal ist die Last klein und leicht, manchmal groß, schwer und sperrig, manchmal klemmen wir sie uns unter den Arm, hängen sie uns über den Rücken, setzen sie uns auf den Kopf, nehmen sie an die Hand oder legen sie uns auf die Schulter. Manchmal sieht es anmutig und geschickt aus, manchmal schleppen wir uns ab und brechen unter dem Gewicht fast zusammen. Meistens ist die Last irgendetwas von Wert, sonst würden wir uns nicht damit abschleppen. Vielleicht tragen wir auch deshalb gerne unsere Kinder – was gibt es Wertvolleres als sie?
Seelische Lasten
Auch unsere Patientinnen und Patienten tragen eine große Last mit sich herum. Ängste, seelische und körperliche Schmerzen, quälende Vorstellungen, Erinnerungen, Zweifel, Hoffnungslosigkeit, kaum auszuhaltende Einsamkeit. Sie kommen zu uns, weil sie nicht mehr wissen, wie sie sie tragen sollen und erhoffen von uns, von ihr befreit zu werden. Und natürlich ist es auch unsere Aufgabe, mit ihnen daran zu arbeiten, einen Teil dieser Last loszuwerden – soweit das möglich ist. So schauen wir z. B. nach Möglichkeiten, unzuträgliche Lebensbedingungen zu verändern, schwierige Situationen besser zu gestalten, Problemlösekompetenzen, kommunikative Fähigkeiten oder die Selbstfürsorge zu verbessern und vieles mehr. Und dennoch können wir ihnen nicht all ihre Last abnehmen, ein großer Teil wird bleiben: unwiederbringliche Verluste, Wunden, die sich nicht schließen, höchstens vernarben, eine allgemein menschliche oder auch individuell-persönliche Verletzbarkeit. Es schmerzt, am Leben zu sein.
Übung: Es wird leichter, wenn wir unsere Last annehmen
Eine wichtige Voraussetzung dafür, eine Last gut zu tragen, besteht darin, sie erst einmal anzunehmen. Dies lässt sich sehr schön mit einer kleinen Übung veranschaulichen. Geben Sie einer Patientin z. B. einen schweren oder unhandlichen Gegenstand in die Hand (z. B. ein dickes Buch oder einen Stuhl) und bitten Sie sie, das Objekt eine Zeit lang – z. B. ein bis zwei Minuten – durch den Raum zu tragen und zwar zunächst auf eine ablehnende Weise. »Sie mögen das Ding nicht, Sie lehnen es ab. Versuchen Sie, jeden Kontakt mit ihm so gut es geht zu vermeiden, halten Sie es so weit weg von sich, wie es geht.« Nachdem die Patientin ein paar Runden mit dem Gegenstand am ausgestreckten Arm gedreht hat, verändern Sie, eventuell nach einer kurzen Pause, die Anweisung: »Tragen Sie den Stuhl nun weiter, aber stellen Sie sich nun vor, dass Sie kein Problem mehr mit ihm haben. Sie akzeptieren ihn, wie er ist, lassen den Kontakt zu, tragen ihn so, wie es am natürlichsten und bequemsten für Sie ist.« Lassen Sie die Patientin die beiden Erfahrungen miteinander vergleichen. Meistens wird sie beschreiben, dass es bei der ersten Variante deutlich mehr Kraft gekostet hat und unangenehmer war, den Gegenstand zu tragen, als bei der zweiten. »Lange hätte ich das nicht mehr ausgehalten«, sagt sie vielleicht. »Ist es möglich«, können wir dann fragen, »dass sich auch die seelische Last, die wir mit uns herumtragen, sehr viel besser aushalten lässt, wenn wir sie annehmen – als wenn wir sie als Feind betrachten und möglichst weit weg von uns haben wollen?«.
Seine Last als verletzbares menschliches Wesen mit Würde zu tragen heißt nicht, immer gut dabei auszusehen und keine Miene zu verziehen oder gar fröhlich und unbeschwert zu sein. Man darf auch mal Rotz und Wasser heulen und zittrige Knie bekommen, natürlich. Aber wenn wir akzeptieren, dass all das dazugehört, macht uns unsere Traurigkeit nicht noch trauriger, haben wir weniger Angst vor unserer Angst und ärgern uns nicht mehr so sehr über unseren Ärger.
Schmerzhaft – und doch kostbar
Kommen wir noch einmal zu dem Gedanken zurück, dass die Dinge, die wir tragen, meist irgendeinen Wert für uns haben. Was könnte wertvoll sein an den emotionalen Lasten, die wir Menschen oft mit uns herumtragen? Andersherum gefragt: »Was müsste dir egal sein, um nicht zu fühlen, was du fühlst?« Diese klassische ACT-Frage führt oft zu der Erkenntnis, dass es unsere Gefühle sind, gerade die schmerzhaften, die uns zeigen, was für uns wirklich zählt. Auch das Wertetagebuch, in dem erlebte Gefühle daraufhin angeschaut werden, auf welche persönlichen Werte sie verweisen, nutzen wir in ACT, um den Zusammenhang zwischen emotionalen Reaktionen und den »Herzensangelegenheiten« unserer Patienten zu verdeutlichen. Oder die Matrix: Was sagt »Das tut mir weh« aus über »Das ist mir wichtig«? (Für Eingeweihte: Worin besteht die Verbindung zwischen links unten und rechts unten?).
Unsere Gefühle helfen uns dabei, unseren Wertekompass zu definieren und nicht aus dem Blick zu verlieren. Ohne sie wären wir verloren.
Der Autor
Dipl.-Psych. Matthias Wengenroth ist als Psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis in Solingen tätig und setzt dabei seit etwa anderthalb Jahrzehnten die Akzeptanz- und Commitmenttherapie ein. Am 21.08.2025 ist bei Beltz von ihm die dritte Auflage des Therapie-Tools-Bandes »Akzeptanz- und Commitmenttherapie« erschienen.
Mehr zum Thema: Akkreditiertes E-Learning
Sie möchten erfahren, wie die Bearbeitung der sechs zentralen ACT-Prozesse aussehen und gelingen kann? Lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo alles über Achtsamkeit, Selbst als Kontext, Defusion, Akzeptanz, Werte und Engagiertes Handeln in unserem akkreditierten Web Based Training »Akzeptanz- und Commitmenttherapie«.