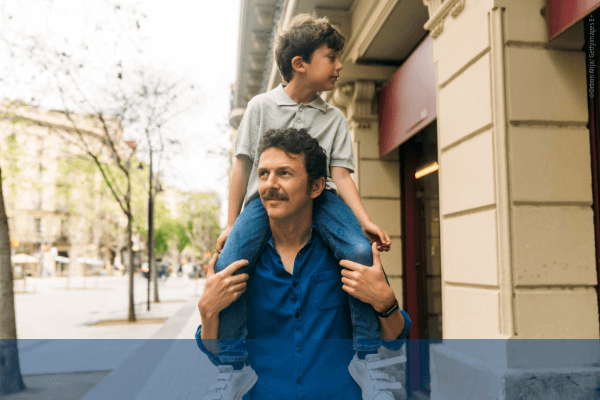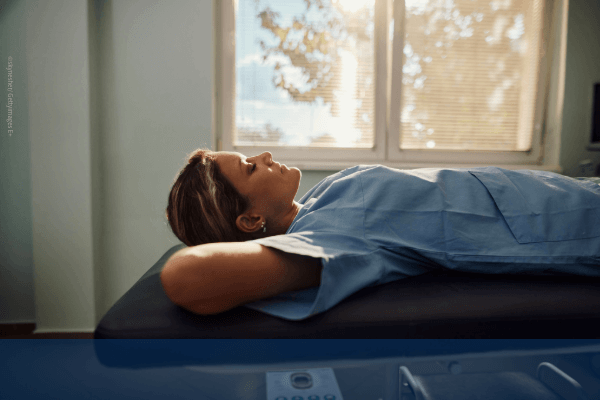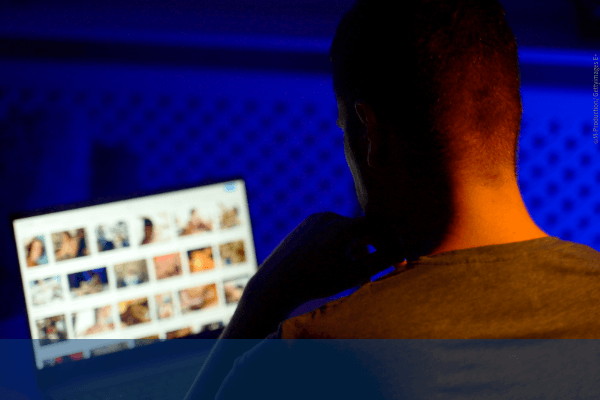In der psychotherapeutischen Sitzung wird oft hauptsächlich gesprochen – die Sinne und der Körper dabei eher weniger einbezogen. Dabei kann es nicht nur einmalige AHA-Momente zutage fördern, den Fokus auf das Spüren zu legen: Den Körper und alle Körperwahrnehmungen einzubeziehen, stellt eine kraftvolle Erfahrung dar. Wie Körperorientierung wirken kann und welche Übungen sich – ohne viele Hilfsmittel – einfach durchführen lassen, lesen Sie hier.
Psychotherapie lebt von Begegnung, Veränderung und manchmal auch von den kleinen und großen Erfolgserlebnissen unserer Patient:innen. Doch genauso gehören die Momente dazu, die weniger erfreulich sind, die uns fordern, frustrieren oder auch an unsere eigenen Grenzen bringen. Konfrontieren kann dann der entscheidende Wendepunkt in Richtung Veränderung sein.
In Therapiesituationen kann es vorkommen, dass nicht nur das Störungsbild und die dazugehörigen Symptome sich als herausfordernd gestalten, sondern auch die Beziehung mit den Patient:innen. Oft mag das Verhalten der Patient:innen und die daraus resultierende Therapiebeziehung mit dem Störungsbild zusammenhängen, gleichzeitig können Momente in der Patientenbeziehung auch Therapieschritte blockieren. Hier kann helfen, die Motivation der Patient:innen zu verstehen und mit Methoden der Plananalyse zu arbeiten.
Wenn Eltern mit Angststörungen leben, spüren das vor allem ihre Kinder: überprotektives Verhalten, Angstschweiß, Sorgen oder einfach nur das Gefühl, »irgendetwas ist in unserer Familie anders«. Studien zeigen, dass diese Belastungen das Risiko für eigene psychische Probleme deutlich erhöhen können. Frühe Interventionen, Psychoedukation und verständliche Erklärungen helfen, Schuldgefühle und Belastungen zu reduzieren. Kinderfachbücher können dabei eine erstaunliche Brücke schlagen: Sie erklären, was Erwachsene oft kaum in Worte fassen können, und schenken Kindern Mut, um über ihr Erleben zu sprechen.
Wenn Kinder und Jugendliche mit komplexen Symptomen in die therapeutische Praxis kommen, kann es schwierig sein, die Hintergründe des Problemveraltens zu ergründen. Wenn sich dann noch die Kontaktaufnahme mit den familiären Bezugspersonen holprig gestaltet und auf allen Seiten Frustration spürbar wird, kann die Beziehungsgestaltung zur Herausforderung werden. Wie emotionale Aktivierung mithilfe schematherapeutischer Verfahren gelingen und Veränderungsprozesse angestoßen werden können, lesen Sie im Beitrag.
Wie kann Achtsamkeit helfen, Rückfälle zu verhindern und mit Grübeln, Ängsten oder innerem Druck anders umzugehen? Die Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) ist ein strukturierter 8-Wochen-Kurs zu mehr Präsenz, Selbstmitgefühl und psychischer Stabilität. Ursprünglich zur Rückfallprophylaxe bei Depression entwickelt, zeigt dieser Beitrag, warum MBCT heute auch transdiagnostisch bei anderen psychischen Störungen wirkt und was es braucht, damit Achtsamkeit im therapeutischen Kontext lebendig wird.
Gefühle und Gedanken können für Patient: innen mitunter sehr quälend sein. Oft liegt es vermeintlich nahe, schwierige und belastende Emotionen verdrängen oder ausblenden zu wollen – dabei kann genau das Gegenteil die Lösung sein: Auch die Gefühle anzunehmen, die sich wie eine Last anfühlen, kann ihr Gewicht verringern. Wieso das so ist und wie Akzeptanz die Grundlage für ein werteorientiertes Lebens sein kann, lesen Sie im Beitrag.
Wenn Kinder und Jugendliche ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten kennen, erleben sie sich als wirksam und gestärkt. Experimente mit AHA-Effekt sind kreative, leicht umsetzbare Übungen, um Ressourcen erfahrbar zu machen und symbolisch zu verankern. Dabei wir nicht nur der Therapiealltag aufgelockert, sondern die kleinen Patient:innen werden aktiv beteiligt und das Erlebte und Gefühlte verfestigt sich stärker. Ob Gummibärchen, die »über sich hinauswachsen«, oder verborgene Schätze im Sand – lesen Sie hier mehr über dieses inspirierende Werkzeug für die therapeutische Praxis!
Viele Emotionen sind körperlich erlebbar. Besonders viele rufen Angst hervor: Veränderungen in der Atmung und im Puls, muskuläre Anspannung, stärkeres Schwitzen. Um diese Körperreaktionen sichtbar zu machen eignet sich Biofeedback besonders gut. So wird nicht nur eindeutig sichtbar gemacht, was im Körper vor sich geht – für Patient:innen wird es erlebbar und verständlich. Warum die Sichtbarmachung der Verbindung zwischen Emotion und Körper so sinnvoll ist und warum sich der Einsatz in der Psychotherapie lohnt, lesen Sie hier.
Nachts schlaflos im Bett zu liegen, ist eine quälende Angelegenheit – und das Jahr um Jahr für immer mehr Menschen. Quälend zum einen aufgrund der Folgen von zu wenig Schlaf. Und zum anderen, weil das Schlimmste daran mitunter die eigenen Gedanken sind: Unmut und Anspannung über das Wachsein, Sorgen und Grübeln können in diesen Nächten der größte Stressfaktor sein. Umso wichtiger, Patient:innen mit Schlafstörungen zu neuen Perspektiven auf die Nacht zu verhelfen. Am besten eignen sich dafür Impact-Techniken, für die gilt: Je eindrücklicher die Vermittlung, desto stärker die Verankerung der neuen Sichtweisen und Gedanken bei den Patient:innen.
Geht es in der therapeutischen Sitzung um das Thema Sex, so nimmt Scham aufseiten der Patient:innen oft eine größere Rolle ein. Ganz besonders, wenn es um den Konsum von Pornografie geht. Pornografische Inhalte sind heutzutage allgegenwertig und so einfach zugänglich wie nie zuvor. So ist es nicht überraschend, dass Pornografienutzung als Verhaltenssucht für immer mehr Menschen zum Problem wird. Mit welchen Schritten Sie Patient:innen den Einstieg in ein Gespräch ermöglichen und warum dafür die therapeutische Selbsterfahrung so wichtig ist, lesen Sie im Beitrag.
Alkohol ist die einzige Droge, bei der man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht konsumiert – ob auf Feiern und Festivitäten, nach dem Feierabend im Kollegenkreis, beim Abendessen mit Freunden oder einfach so. Alkoholkonsum ist gesellschaftlich nicht nur akzeptiert, sondern sogar kulturell verankert.
Dabei ist übermäßiger Konsum und Abhängigkeit verbreitet. Gerade dann wird die Problematik von den Betroffenen allerdings meist heruntergespielt. Wie Sie Menschen auf dem Weg zu einem Leben ohne Alkohol therapeutisch begleiten können, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Dabei ist übermäßiger Konsum und Abhängigkeit verbreitet. Gerade dann wird die Problematik von den Betroffenen allerdings meist heruntergespielt. Wie Sie Menschen auf dem Weg zu einem Leben ohne Alkohol therapeutisch begleiten können, erfahren Sie in diesem Beitrag.