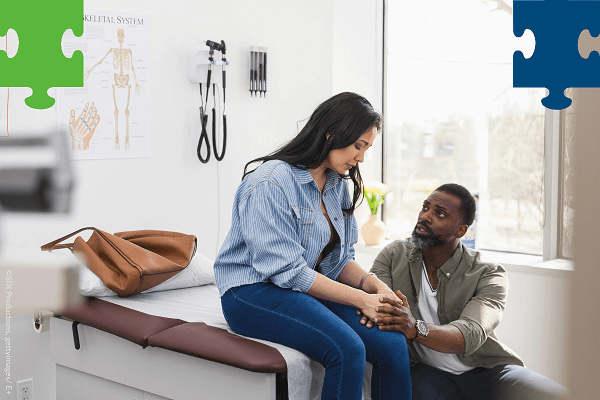Christine und Luka sind beide Mitte 30 und wirken sehr traurig, als sie in ihre Praxis kommen. Luka ergreift das Wort: »Wir sind seit über einem Jahr in Kinderwunschbehandlung, da es für uns aufgrund verschiedener Komplikationen sowohl auf meiner als auch auf der Seite meiner Frau nicht möglich ist, auf »normalem« Wege schwanger zu werden. Wir haben es zunächst mit einigen Inseminationen versucht, leider waren die alle erfolglos. Nun habe wir gerade unsere erste ICSI hinter uns und wissen nun seit einer Woche, dass auch diese erfolglos war.« Dabei schaut er hilflos zu Christine, die in diesem Moment anfängt zu weinen. Luka fährt fort: »Sie sehen ja, uns belastet die Situation sehr. Christine musste sich Spritzen setzen, Hormone nehmen, unter Vollnarkose die Eientnahme durchführen – für nichts und wieder nichts. Wir sind einfach so enttäuscht. Dazu kommt, dass unsere Freunde und Familie gar nicht Bescheid wissen, weil wir das nicht wollten. In unserem Freundeskreis bekommen derzeit alle Kinder, was für uns schwer zu ertragen ist. Wir ziehen uns immer weiter zurück und die verstehen gar nicht, warum. Außerdem drängt meine Schwiegermutter ständig mit der Frage, wann es denn bei uns endlich so weit sei. Ich mache mir große Sorgen um Christine. Ich habe Angst, dass sie noch depressiv wird. Und ich bin mir einfach so unsicher, ob wir echt noch eine weitere ICSI wagen sollen.« Christine ergänzt: »Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass ich mir so sehr ein Kind gewünscht habe und so froh war, als wir beschlossen haben, mit dem Kindermachen loszulegen. Jetzt ist das Ganze zu einem Alptraum geworden. Ich wünsche mir immer noch so sehr ein Kind, und gleichzeitig habe ich auch Angst, dass mich ein weiterer missglückter Versuch kaputt macht. Und ich fühle mich so alleine damit. Alle meine Freudinnen schwelgen im Kinderglück. Ich komme mir vor wie auf einem anderen Planeten. Ich kann deren Glück nicht ertragen, und die wissen gar nicht, was bei mir los ist, und würden es sicher auch gar nicht verstehen.«
Kinderwunsch als zentrales Lebensziel für viele Menschen
Ein Kind in die Welt zu setzen gehört für die meisten Menschen zu den absolut zentralen Lebenszielen. Gerade in Frauen ist dieses Bedürfnis sehr tief eingepflanzt, aber auch bei Männern spielen Kinder bzw. die Sehnsucht nach ihnen häufig eine ganz zentrale Rolle im Leben. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Paare häufig verzweifeln, wenn der Entschluss, schwanger zu werden, über zu lange Zeit nicht zum Erfolg führt. Ab wann spricht man überhaupt von einem unerfüllten Kinderwunsch? Die World Health Organisation (WHO) fokussiert dabei auf ein Zeitkriterium und spricht von Infertilität, wenn eine Frau innerhalb eines Jahres trotz regelmäßigen ungeschützten Geschlechtsverkehrs nicht schwanger wird. Wie immer bei künstlichen Grenzziehungen muss aber letztlich im Einzelfall beurteilt werden, ob ein unerfüllter Kinderwunsch mit entsprechendem Leidensdruck vorliegt.
Das mit dem Kinderwunsch einhergehende Leiden kann außerordentlich vielfältig sein: Partnerschaftsprobleme, Stimmungseinbrüche durch immer wieder zerstörte Hoffnungen, Selbstwertzweifel, Leiden an den Folgen medizinischer Eingriffe (z. B. Schmerzen) – die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Entsprechend hochkomplex können die Beratungsanliegen von Kinderwunsch-Paaren sein. Wir möchten im Folgenden die wichtigsten Leidensbereiche von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch beschreiben, um darauf aufbauend darzulegen, für welchen Teil davon eine Paarberatung die richtige Adresse sein kann und wie diese aussehen sollte.
Probleme von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch in der Frühphase
Wenn ein Paar sich dazu entschließt, Kinder zu bekommen, ist eine der ersten Maßnahmen natürlich, die Verhütung wegzulassen. Bereits davor oder unmittelbar nach diesem Schritt sind selbstverständlich auch paarrelevante Fragen möglich (»Wollen wir überhaupt ein Kind? Sind wir dazu bereit? Wann passt ein Kind denn am besten in unser Leben hinein?«). […] Die hier angerissenen Probleme von Paaren, die noch gar nicht mit der Reproduktionsmedizin in Kontakt gekommen sind, sollten nur veranschaulichen, dass eine große Zahl an unterschiedlichsten Schwierigkeiten möglich ist. In dieser frühen Phase der Infertilität besteht die Aufgabe des Paartherapeuten darin, mit dem Paar sehr individuell zu schauen, welche konkreten Belastungen gegeben sind und hierfür emotionalen Support und konkrete Hilfestellung anzubieten. Da die jeweiligen Anforderungen auf die vom Paar konkret berichteten Probleme zuzuschneiden sind, können wir hier keine erschöpfende Auflistung therapeutischer Interventionen versuchen. In jedem Falle wichtig ist ein empathischer, validierender und emotional unterstützender Grundton, von dem aus dann je nach konkretem Problem spezifisch interveniert wird. Hierzu gehört natürlich auch die von Paaren in dieser Phase häufig gewünschte Aufklärung über reproduktionsmedizinische Maßnahmen. Sehr häufig sind die Paare schon vorinformiert. Deshalb müssen Paartherapeuten, die in diesem Bereich tätig sein möchten, solide Grundkenntnisse der reproduktionsmedizinischen Terminologie besitzen und die Abläufe in entsprechend spezialisierten Ambulanzen und Kliniken kennen. Ansonsten ist eine gute Beratung von Paaren, die hier verunsichert sind und nach dem für sich richtigen Weg suchen, nicht möglich. Auch möchten wir darauf hinweisen, dass Paare mit unerfülltem Kinderwunsch häufig extrem angespannt und verletzlich sind, was angesichts der Tatsache, dass es sich um einen zentralen und existenziellen Lebenswunsch dreht, der in Gefahr ist, auch nachvollziehbar ist. Die Grundhaltung im Umgang mit solchen Paaren sollte deshalb durch größtmögliche Empathie gekennzeichnet sein. Insbesondere ist es sehr wichtig, dass Therapeuten nicht »voranpreschen«, beispielsweise mit vorschnellen »Plan-B«-Erwägungen (»Haben Sie sich schon überlegt, ob Adoption was für Sie wäre?«). Häufig reagieren Paare auf solche ihre eigenen Gefühle überholenden Interventionen mit sofortigem Rückzug, da sie sich in ihrer Not nicht verstanden fühlen. Deshalb raten wir sehr stark dazu, mit den Interventionen sozusagen immer gut Schritt zu halten mit dem Paar, aber nicht einem Impuls zur Beschleunigung nachzugeben. Eine sehr bedeutsame Frage, die entweder vom Paar selbst aufgebracht wird oder aber wenn irgend möglich vom Therapeuten angesprochen werden sollte, betrifft den Umgang mit dem sozialen Umfeld. Prinzipiell ist diese Frage eigentlich erst dann wirklich brisant, wenn ein Paar sich in Reproduktionsmedizin begibt und damit unter Umständen für längere Zeit der Dynamik der »Und, wie ist es gelaufen? Seid ihr endlich schwanger?«-Frage aussetzt. Das Thema »Wer soll von unserem Kinderwunsch erfahren?« ist somit sehr bedeutsam, weil es sehr stark reguliert, wie Interaktionen im sozialen Raum in nächster Zeit ablaufen. Es ist deshalb günstig, diese Fragen in der Beratung so früh wie möglich zu eruieren, noch bevor das Paar irgendjemandem von seinen Absichten erzählt – denn wenn die Information einmal »draußen« ist, kann das Paar sie natürlich nicht mehr wieder zurückholen und hat deutlich weniger Kontrolle. Therapeuten sollten in der Arbeit mit Kinderwunsch-Paaren von Anfang an eine möglichst nicht festgelegte und sehr frei explorierende Grundhaltung verkörpern (wir vertiefen diese Haltung im Abschnitt »Eröffnung des Beratungssettings und Auftragsklärung«). Dann stehen die Chancen gut, dass der Therapeut bereits Informationen dazu erhält, ob das Paar über seinen Kinderwunsch bereits mit jemandem gesprochen hat oder nicht. Im günstigsten Fall wird die Frage dadurch sozusagen »abholbar« (»Sie sagten gerade, dass Sie außer jetzt mit mir noch mit niemandem über Ihren Kinderwunsch gesprochen haben. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema: wem erzählen und wem nicht, und was davon hat welche Konsequenzen? Wenn Sie das auch für ein bedeutsames Thema halten, dann können wir darüber sprechen.«) und der Therapeut muss sie nicht »in den Raum platzen lassen« (»Mal was ganz anderes: Haben Sie eigentlich schon darüber nachgedacht, wie die Zukunft aussieht, wenn Sie das mit dem Kinderwunsch Ihren Eltern erzählen?«). Das Paar sollte dann sehr gut darin begleitet werden, die für die eigene Lebenssituation besten Entscheidungen zu treffen, wen es wie informieren möchte und wen nicht. Wenn bereits Personen informiert wurden und sich aus Sicht des Paares nicht hilfreich verhalten (»Meine Mutter fragt seitdem jede Woche mit einem Augenzwinkern, ob es denn schon geklappt hat …«), dann sollte das Paar darin unterstützt werden, mit den betreffenden Personen das Gespräch zu suchen und die Probleme offenzulegen. Dies kann in der Beratung gegebenenfalls auch in Rollenspielen geübt werden. Wir raten jedenfalls dazu, diesen Punkt mit einem Paar sehr gründlich zu besprechen, denn nicht selten ziehen sich Kinderwunsch-Behandlungen über Monate bis Jahre hin. In dieser Zeit z. B. durch unsensible Fragen fortgesetzt interpersonelle Belastungen aushalten zu müssen, ist ein Zusatzstressor, der möglichst vermieden werden sollte.
Paare in reproduktionsmedizinischer Behandlung
Irgendwann wird ein Paar den Glauben daran aufgeben, auf natürlichem Weg zu einer Schwangerschaft zu gelangen und sich an die Reproduktionsmedizin wenden. Anders als die anderen Themen in diesem Buch ist der Bereich »Kinderwunsch« somit extrem stark medizinisch beherrscht. ICSI, Insemination, Ovarialinsuffizienz, GnRH-Agonisten – Paare, die nicht auf natürlichem Wege zu einer Schwangerschaft kommen und eine Kinderwunsch-Sprechstunde aufsuchen, werden in der Regel innerhalb kurzer Zeit mit einer Flut an Fachbegriffen konfrontiert bzw. müssen sich mit diesen auseinandersetzen, wenn sie verstehen wollen, was genau biologisch bei ihnen passiert bzw. die Ärzte mit ihnen machen. Die moderne Reproduktionsmedizin ist ein Feld mit einer Vielzahl an Professionen, Diagnoseansätzen und Therapieverfahren. Trotzdem beginnt mit dem Überschreiten der Schwelle einer hierauf spezialisierten Praxis für viele Paare ein mehr oder weniger langer Leidensweg, denn einen sicheren oder gar schnellen Weg zur Schwangerschaft gibt es in vielen Fällen nicht. Hinzu kommt, dass Paare dann, wenn sie diesen Weg beginnen, meist schon angeschlagen sind von den meist Monaten bis Jahren des vergeblichen Versuchs, ohne medizinische Hilfe schwanger zu werden. Es ist somit nicht verblüffend, dass sich bei Paaren mitunter verschiedenste Probleme auftürmen, die sie schließlich auch den Weg in die Paartherapiepraxis finden lassen.
In der Praxis haben wir zahlreiche Berichte von Kinderwunsch-Partnern geschildert bekommen, die in ihrer Konfrontation mit der Reproduktionsmedizin schwer belastende Situationen erlebt haben. Diese reichen von ungenügender Aufklärung und dadurch bedingter Verunsicherung über mit den Untersuchungen und Behandlungen einhergehende Belastungen bis hin zu unsensiblen oder gar verletzenden Verhaltensweisen der in diesem Feld tätigen Professionellen (nicht nur auf die Ärzte eingegrenzt, sondern alle Berufsgruppen umfassend).
Die Belastungskurve der Paare zeigt somit häufig schon kurz nach Eintritt in die Reproduktionsmedizin deutlich nach oben, womit sich viele der im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Probleme deutlich verstärken. Durch die nicht unerheblichen Kosten der medizinischen Behandlung kommt relativ früh ein neues Problem hinzu. Die Kosten, die im Rahmen einer reproduktionsmedizinischen Behandlung entstehen, sind erheblich und die konkreten Regulierungsrichtlinien der Kassen unterschiedlich und mitunter schwer durchschaubar. Wenn eine Samenspende zum Thema wird, dann verkompliziert sich die Lage weiterhin deutlich, da auf einmal auch noch solche Fragen wie Ansprüche des Spenders, Erbrecht etc. geklärt werden müssen. Bei einer Eizellenspende wird es noch komplizierter, da diese in Deutschland sogar verboten ist und sich die Paare somit ins Ausland wenden müssen. Die Notlage, in der sich die Paare befinden, wird damit um eine neue Dimension ergänzt: Sie müssen sich zusätzlich zur psychischen Belastung, die mit der Kinderlosigkeit einhergeht, nun auch noch mit Krankenkassenrichtlinien, Paragraphen, eventuell Ablehnungsbescheiden, Gutachten, der Rechtsprechung usw. herumschlagen und auch im Falle der Kostenübernahme in der Regel (bei gesetzlicher Versicherung) erhebliche Geldmittel aufwenden.
Wenn sich ein Paar dann zu einer medizinischen Behandlung entschließt, beginnt häufig ein Kreislauf aus:
- schwierigen zu fällenden Entscheidungen: welche Methode? Auch Begleitbehandlungen? Und wenn ja, welche?
- dem Versuch selbst: mit seinen ganz eigenen Belastungen durch Diagnostik und Therapie, z. B. Vorbereitung der Versuche durch Spritzen und orale Medikation inklusive Nebenwirkungen etc.
- dem Hoffen und Bangen um das Gelingen: nach dem Befruchtungsversuch ein Hyperfokus auf Anzeichen des Körpers; bei jedem kleinen Symptom die Angst, dass »etwas schief gelaufen« ist, usw.
- und schließlich leider häufig dem Scheitern des Versuchs, der Trauer und Verzweiflung darüber und daran anknüpfend wieder der Einstieg in den nächsten Entscheidungsprozess.
Je öfter diese Spirale durchlaufen wird, desto zermürbter sind die Paare in der Regel, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen, beispielsweise auch in Form von starken Auswirkungen auf die Partnerschaft – manche Paare schweißt diese Herausforderung noch enger zusammen, andere hingegen sprengt der Konflikt regelrecht auseinander. Insgesamt kann das Sozialleben stark beeinträchtigt werden. Häufig können die Paare, die so verzweifelt um das Schwanger-Werden kämpfen, kaum noch den Anblick von Schwangeren oder glücklichen Eltern mit ihren Kindern ertragen und ziehen sich zurück. Oder ihnen werden die Nachfragen aus dem Familien- oder Bekanntenkreis (»Und, bist du endlich schwanger?«) zu viel, und in der Folge ziehen sie sich immer mehr zurück. Generell ist die Frage des Umgangs mit dem Umfeld sehr wichtig. Viele Paare antizipieren die hier genannten Probleme und sind sich deshalb unsicher, ob und wenn ja wem aus ihrem Umfeld sie überhaupt von den Versuchen der künstlichen Befruchtung erzählen sollen. Entferntere Bekannte hier nicht einzubeziehen ist in der Regel unproblematisch, doch wie ist mit den engeren Freunden, der Familie, dem Arbeitgeber umzugehen? Auch mit solchen Fragen wenden sich Paare mitunter in die Beratung, weil sie Hilfe bei der Entscheidung benötigen, wem sie was berichten und welche Konsequenzen damit jeweils verbunden sind.
Wenn sich Fehlversuche häufen, dann wird sich das Paar natürlich irgendwann auch der Frage zuwenden, ob eine Fortsetzung der Versuche überhaupt noch aussichtsreich ist. Meistens ist es einer der beiden Partner, dem es irgendwann zu viel wird und der aufgeben will. Je nach Haltung des anderen Partners können sich daraus weiter verschärfte Paarkonflikte ergeben (»Ich will auf keinen Fall aufgeben!«), oder aber das Paar gelangt zu einer gemeinsam getragenen Entscheidung, die reproduktionsmedizinischen Bemühungen aufzugeben und sich völlig neu aufzustellen – spätestens damit betreten solche Fragen wie »Adoption«, »Leben ohne Kind« oder andere Varianten die Bühne. Die Fülle der hier aufgezeigten Probleme wird aus unserer Sicht sehr gut im Konzept der sogenannten »Heidelberger Kinderwunsch-Sprechstunde« (Wischmann & Stammer, 2010, S. 97) aufgegriffen. Die Autoren benennen die folgenden »Ziele einer psychologischen Beratung:
- eine bessere Bewältigung der aktuellen Kinderlosigkeit zu ermöglichen
- Informationsdefizite zu beheben
- Entscheidungshilfen bezüglich einzelner medizinischer Behandlungsschritte zu bieten
- mögliche (Paar-)Konflikte bei der Fertilitätsbehandlung zu vermindern
- die Kommunikation miteinander und mit den Ärzten zu verbessern
- mögliche sexuelle Störungen zu bearbeiten
- die Bewältigungskompetenz der Partner zu aktivieren
- die Akzeptanz einer möglicherweise nicht therapierbaren körperlichen Störung zu fördern und
- Unterstützung bei der gegebenenfalls notwendigen Veränderung des Lebensstils und der Lebensziele zu bieten.«
Wir geben im Folgenden orientiert an einem Stadienmodell, das wir an van der Broeck et al. (2010) anlehnen, und unter Bezug auf die Ziele im Rahmen des »Heidelberger Modells« nach Wischmann und Stammer (2010) Beispiele für Interventionen, die bei Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch hilfreich sein können.
Eröffnung des Beratungssettings und Auftragsklärung
Es ist wichtig, von der ersten Beratungssitzung an eine möglichst offene Atmosphäre zu erschaffen, in der von Anfang an deutlich wird, dass die Anliegen des Paares sehr ernst genommen werden und dass der konkrete Kurs der Beratung vom Paar bestimmt wird. [Es ]empfiehlt sich, als Berater so offen aufzutreten wie möglich, nichts festzulegen, Brücken zu bauen und dem Paar erst einmal in allen Punkten den Vortritt zu lassen, um dann von dort aus geleitet langsam weiter vorzugehen. Die Einleitung ins Gespräch sollte also minimal strukturierend erfolgen, um erst einmal einen Eindruck zu bekommen, wo das konkrete Paar steht.
- »Sie haben bei der Anmeldung am Telefon gesagt, dass Sie sich wegen eines unerfüllten Kinderwunsches an uns gewandt haben. Das ist ein sehr persönliches Thema. Was möchten Sie mir zu Ihrer Situation sagen? Oder haben Sie Fragen an mich, die Sie vorher lieber noch klären möchten?«
- »Sie haben am Telefon gesagt, dass Ihr Arzt, Herr X., Sie hierher geschickt hat. Wie geht es Ihnen damit, jetzt hier zu sein? Ich möchte Ihnen von Anfang an signalisieren, dass Sie hier alles fragen und sagen dürfen, was Ihnen in den Sinn kommt.« – »Nee, ist schon in Ordnung, dass wir hier sind. Dr. X. meinte, dass Sie uns vielleicht helfen können. Wir sind da aber, na ja, also …« – »Wenn ich es richtig höre, dann sind Sie skeptisch, was so eine Beratung hier Ihnen bringen soll. Sollte das so sein: Das ist völlig in Ordnung. Ich wäre an Ihrer Stelle auch skeptisch – wenn man irgendwo hingeschickt wird, dann ist das eigentlich eine total gesunde Haltung.« – »Also nicht, dass wir Ihnen nicht trauen. Aber ich meine, unser Problem ist ja ein medizinisches. Was soll da eine Psycho-Beratung nutzen?« – »Ja, ich verstehe Sie. Wenn Sie möchten, dann kann ich Ihnen erst mal etwas darüber erzählen, was solch eine Beratung überhaupt leisten kann. Oder Sie erzählen mir erst einmal etwas über Ihre konkrete Situation. Ganz wie Sie wollen, Sie können das wählen, wie es für Sie besser ist.« – »Okay, vielleicht sagen wir erst mal kurz was zu uns, und Sie erzählen dann was darüber, was Sie so anbieten können. Also, bei uns …«
Wenn es durch solche Interventionen gelungen ist, einen ersten Draht zum Paar zu bekommen und einen groben Rahmen abzustecken, dann sollte der Auftrag geklärt werden, auch um unrealistische Ideen zu erkennen und früh zu beantworten.
»Okay, wenn es Ihnen recht ist, würde ich gerne einmal kurz zusammenfassen, was ich von Ihnen bisher verstanden habe, um zu sehen, ob mein Bild stimmt. Einverstanden?« – »Ja.« – »Also, bei mir ist angekommen, dass … [knapp zusammenfassen]. Stimmt das so weitgehend, oder möchten Sie etwas hinzufügen oder ändern?« – »Nein, das passt so.« – »Okay. Haben Sie Gedanken dazu, was Sie sich von einer Beratung wünschen? Welche Ziele Sie damit verbinden?«
- »Nein, eigentlich haben wir keine wirkliche Idee dazu. Es geht uns einfach total schlecht mit der Situation, und wir glauben, es wäre einfach mal gut, das nicht immer nur mit uns selbst auszumachen. Mit den Ärzten kann man nur über medizinische Sachen reden, aber wie es uns innen drin geht, das hat da gar keinen Platz. Also, hm, macht das irgendwie Sinn?« – »Ja, vollkommen. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann fehlt Ihnen einfach eine dritte Person, mit der Sie sich mal die menschliche Seite anschauen können. Und die ›Profis‹, mit denen Sie bislang Kontakt hatten, die kümmern sich sozusagen nur um die Biologie.« – »Ja, ganz genau! Aber diese ganze Scheiße macht was mit uns, wir merken langsam, dass uns das kaputt macht. Wir wissen auch nicht, was wir dagegen tun sollen, aber wie gesagt, vielleicht hilft ja einfach mal drüber reden.« – »Ja, das kann ich sehr gut verstehen, und es freut mich, dass Sie den Weg zu uns genommen haben. Denn in der Tat ist das hier genau solch ein Ort, wo Sie Ihre Sorgen und Nöte ausdrücken können, und von da aus können wir dann schauen, was es für Möglichkeiten gibt.« – »Denken Sie denn, dass man da etwas machen kann? Also, dass Sie uns helfen können?« – »Ich bin zuversichtlich, dass wir hier, wenn Sie das wollen, Ideen finden und ausprobieren können, die es Ihnen erlauben, mit Ihrer Situation besser klar zu kommen. In der Beratungsstelle arbeiten wir sehr viel mit Paaren, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Es hilft Ihnen jetzt erst mal noch gar nicht, aber ich kann Ihnen von der Erfahrung mit den anderen sagen, dass viele hier mit einem persönlichen Gewinn wieder rausgehen.« – »Das klingt nicht schlecht.« – »Schön, wenn Sie das dann möchten, dann schlage ich vor, dass wir uns Ihre ganz konkrete und persönliche Situation einmal genauer anschauen.«
- »Ja, wir haben sehr genaue Vorstellungen. Was uns fehlt, ist eine gründliche Information über die Möglichkeiten, die es alles so gibt. Uns schwirrt der Kopf, weil die Ärzte einem alle möglichen Fachbegriffe an den Kopf werfen. Wir waren jetzt schon bei drei Ärzten, und alle drei empfehlen unterschiedliche Dinge. Dann ist da noch eine Freundin, die hat parallel zur ICSI noch Homöopathie und Akupunktur gemacht. Wir wissen in dem Dschungel nicht mehr, was wir machen sollen. Das würden wir gerne sortieren.« – »Ja, ich kann Sie gut verstehen, dass Sie sehr verwirrt sind. Die Reproduktionsmedizin ist unglaublich kompliziert, und es gibt so viele verschiedene Methoden, Begleitverfahren, geprüfte und weniger geprüfte Behandlungsideen, da kann man den Überblick verlieren. Wenn ich es richtig höre, dann wollen Sie mit mir sozusagen eine Gesamt-Bestandaufnahme machen und dann eine Entscheidung treffen, was konkret Sie selbst machen möchten?« – »Ja, genau. Es wäre am tollsten, wenn Sie uns sagen könnten, was die beste Maßnahme ist. Sie haben hier ja viele Paare, die dieselben Probleme haben, nehmen wir an. Was hat denen denn am besten geholfen? Ist Akupunktur nun gut oder nicht?« – »Das ist leider gar nicht wirklich zu beantworten, weil es in diesem Bereich keine klaren Erkenntnisse gibt. Das Bild ist tatsächlich so, wie Sie es erleben. Es gibt alle möglichen Maßnahmen, die wissenschaftlich unterschiedlich gut untersucht sind. Ich kann Ihnen hierzu gerne die Informationen geben, die ich habe bzw. Sie bei der Informationssuche unterstützen und Ihnen dabei helfen, in dem Dickicht eine Entscheidung zu treffen. Aber leider kann ich Ihnen nicht sagen, was die ›richtige‹ Entscheidung ist. Denn das kann man im Moment überhaupt nicht wissen. Glauben Sie mir, wenn ich wüsste, mit welcher Vorgehensweise Sie die beste Chance hätten, schwanger zu werden, dann würde ich Ihnen das sagen. Aber leider weiß ich das nicht.« – »Hm, schade … Aber eigentlich auch nicht überraschend, denn wenn das klar wäre, dann hätten die Ärzte es uns wohl auch schon gesagt.« – »Ja, so sehe ich das auch. Ich weiß, dass das frustrierend ist und dass Sie gerne Sicherheit hätten. Nochmal: Es tut mir leid, dass ich Ihnen die nicht geben kann. Möglich ist hier allerdings, eine bestmögliche Basis für Ihre Entscheidung zu bekommen. Diese sollten wir aber nicht in Begriffen von ›richtig‹ und ›falsch‹ verstehen, denn dazu ist die Sachlage viel zu komplex. Also, wie sehen Sie vor diesem Hintergrund unsere Arbeit hier?« – »Ja, passt schon, es ist wohl das einzige was geht.« – »Okay. Wie möchten Sie konkret vorgehen?« Hier wurden zwei Varianten dargestellt, wie eine Auftragsklärung verlaufen kann. Natürlich sind noch viele mehr denkbar, doch die aufgezeigten Alternativen mögen genügen, um einen Eindruck davon zu erhalten, wie dieser erste Schritt der Behandlung aufgezogen werden kann. In aller Regel wird – bei einer Fortsetzung der Beratung – der Prozess damit in die nächste Stufe übergehen, in der im Wesentlichen die Exploration der »Welt des Paares« zentral ist.
Öffnung eines Raumes zur Besprechung der Infertilitäts-Erfahrung
Wenn der Boden dafür durch die Kontaktaufnahme und die Auftragsklärung bereitet ist, dann steht in aller Regel im nächsten Schritt die vorsichtige Exploration der aktuellen Lebenssituation, des Kinderwunsches, der Motive, Gefühle und so weiter an. Diese Exploration kann auch die Basis dafür sein, mit dem Paar gemeinsam die Tatsache zu normalisieren, dass es in einer tiefen Krise steckt, und damit verbunden die Vielzahl negativer Gefühle zu validieren. Der Wunsch nach einem Kind kann in seiner Heftigkeit alles andere überstrahlen und derart zentral sein – und das durch den problematischen Verlauf nur noch mehr –, dass ein Paar sich schon »nicht mehr normal« fühlt. Wenn der Therapeut behutsam, aber sorgfältig die vielen mit dem Kinderwunsch in Verbindung stehenden Motivationen (individuelle Motive, transgenerationale Aufträge, soziale Motive etc.) sichtet, dann kann das für das Paar eine stark entpathologisierende Wirkung haben. Im Normalfall zeigt sich, dass dieses Mittelpunktsthema »Kind« in alle nur denkbaren Richtungen ausstrahlt und bei entsprechend wohlwollender und behutsamer Raumeröffnung letztlich kaum ein Thema ausgeklammert bleibt. Die Partnerschaft (»Wie wirkt sich das, was wir gerade erleben, auf uns als Paar aus?«), die Herkunftsfamilie (»Aus was für Familien kommen wir, und was hat das mit unseren eigenen Idealen von ›Familie‹ zu tun?«), die persönliche Identität (»Warum ist mir persönlich ein Kind so wichtig? Welche meiner Werte, Träume, Ziele stehen hier auf dem Spiel?«) – diese Aufzählung und auch die in Klammern gegebenen konkreten Aspekte könnten unendlich fortgeführt werden. Therapeuten haben in diesem Schritt also die Aufgabe, durch fortwährendes Wohlwollen, Validieren und empathisches Nachfragen dem Paar dabei zu helfen, alles für die Partner Wichtige auszusprechen, um es in die Untersuchung mit einzubeziehen. Sehr wichtig ist dabei stets auch die Adressierung der emotionalen Komponente. Die Möglichkeit zum Ausdruck der eigenen Gefühle kann dem Paar sehr dabei helfen, die Krise zu bestehen Deshalb ist die wichtigste Pflicht des Therapeuten in dieser Phase, dem Paar einen unbeeinträchtigten Freiraum zur Exploration auch all der negativen Gefühle zu bieten, die mit der Infertilitäts-Erfahrung einhergehen. Eine besondere Rolle kann dabei die entweder selbst gebildete oder auch ärztlicherseits gestützte Ätiologie der Infertilität spielen. Dabei sind alle Varianten auf ihre Weise belastend. Bei einer klaren Ätiologie, also einer eindeutigen biologischen Ursache für die Infertilität bei einem oder beiden Partnern, kann es sein, dass mit dem medizinischen Befund für den Betroffenen massive Schuldgefühle einhergehen (»Ich bin schuld, dass wir kein Kind kriegen können.«). Van der Broeck et al. (2010) weisen explizit darauf hin, dass sich Therapeuten darum bemühen sollten, Attributionsfehler bei den Partnern zu erkennen und so gut wie möglich gegen sie anzugehen. Konkret heißt das: Wenn es einen klaren medizinischen Befund gibt, dann sind die beim betroffenen Partner resultierenden Schuldgefühle zwar normal und quasi erst einmal unvermeidlich, aber sie führen in die Irre und sollten so bald wie möglich »externalisiert « werden. Aus dem mit der medizinischen Diagnose häufig verbundenen »Ich bin schuld, denn mein Körper ist ein biologischer Versager« sollte ein »Dieser Schicksalsschlag ist unsere Herausforderung« werden. Das ist mit Attributionsfehler gemeint: Niemand sucht sich aus, unfruchtbar zu sein, insofern ist ein Selbstvorwurf an dieser Stelle unberechtigt, denn er unterstellt eine Wahl, die man nicht hatte. […]
Begleitung des Paares während der fortgesetzten Behandlung
Je länger die Kinderwunschbehandlung andauert, desto stärker wird im Regelfall die emotionale Belastung des Paares sein. Mitunter fühlen sich die Paare wie auf einer emotionalen Achterbahn, in der sich Hoffnungen und Frustrationen ständig abwechseln. Die Paare geraten in einen Zustand der Daueranspannung, die im Extremfall überhaupt nicht mehr nachlässt, da jedes Ereignis mit wieder neuen Spannungsimpulsen einhergeht: die Anspannung der Entscheidung im Zulauf auf den nächsten Versuch, dann im laufenden Versuch das Belauern der Schwangerschaft bzw. ihrer Anzeichen (mit der spezifischen Dynamik, dass die Frau ihren Körper »unmittelbar« dauerbewachen kann, während der Mann auf »Berichte« angewiesen ist), und nach dem Scheitern eines Versuchs die sofort anstehende Frage des nächsten. […] Begleitende Maßnahmen können helfen, die Situation etwas zu erleichtern (Entspannungstraining, Ablenkungsstrategien wie bewusste Zeit für Hobbys etc.), aber damit ist in aller Regel die Situation nur etwas entschärfbar, aber nicht auszugleichen. Neben konkreten Effekten, z. B. sich wieder einem Hobby zu widmen, stehen solche aktiven Bemühungen auch in dem Dienst, dem Paar wenigstens wieder ein Minimum an Kontrollerleben zurückzugeben. Sich reproduktionsmedizinischen Maßnahmen zu unterziehen ist in vielerlei Hinsicht ein sehr passiver Prozess. Das Paar sollte darin bestärkt werden, sich in die Behandlung so weit wie nur irgend möglich einzubringen, um sich nicht nur als Spielball der Ereignisse zu erleben; aber daneben sollte auch die aktive Rolle im Gestalten des restlichen Lebens verstärkt werden.
In dieser Phase der fortgesetzten Behandlungen ist weiterhin wichtig, von Seiten der Therapeutin hilfreich auf typische Muster einzuwirken, die sich zeigen können. So ist beispielsweise oft zu beobachten, dass Frauen ein großes Bedürfnis danach haben, über schmerzliche Erfahrungen zu sprechen, auch wenn sich daraus keine änderungsorientierten Handlungen ableiten lassen. Ihre Partner fühlen sich dann häufig hilflos und ziehen sich zurück, was zu einer Polarisation der Partner und zur Isolation führen kann. Dies sollte vom Therapeuten offen angesprochen werden, um dann mit dem Paar gemeinsam Strategien zu überlegen, wie mit den hier entstehenden Bedürfnissen (z. B. emotionaler Halt auf der weiblichen Seite, Vermeidung von Hilflosigkeitserleben auf der männlichen) so umgegangen werden kann, dass sie besser erfüllt werden. Möglicherweise wird auch die Sexualität verstärkt zum Thema. Es wurde schon einige Male darauf hingewiesen, dass sich im Verlauf einer reproduktionsmedizinischen Behandlung sexuelle Probleme entwickeln können, da die Sexualität auf einmal völlig aus ihrem früheren Kontext herausgerissen ist. Es ist denkbar, dass ein Paar aus Schamgründen nicht von sich aus von sexuellen Problemen spricht, weshalb diese beizeiten vom Therapeuten angesprochen werden sollten:
»Sehr viele Paare, die so wie Sie über längere Zeit wegen ihres Kinderwunsches in medizinischer Behandlung sind, entwickeln Probleme im Bereich Sexualität. Ich möchte Ihnen nichts einreden oder aufdrängen, aber ich möchte Ihnen signalisieren, dass wir hier auch darüber ganz offen sprechen und nach Lösungen suchen können.«
Arbeit mit Paaren nach mehreren erfolglosen Versuchen
In der Regel spätestens nach dem dritten Versuch – weil ab dann die Krankenkassen keine Zuzahlung mehr leisten –, mitunter aber auch früher oder später kann sich einem Paar die Frage stellen, wie lange es die medizinische Behandlung aufrechterhalten, wie viele Versuche es noch eingehen möchte. Dies ist ohne Zweifel einer der heikelsten Punkte in der gesamten Behandlung. Denn mit dem Beenden der Versuche ist für das Paar natürlich als Konsequenz das Begraben eines sehr zentralen Lebenstraumes verbunden, weshalb die Schmerzen an dieser Stelle maximal sein können. Es kann sein, dass sich die Frage nach dem »Wie lange noch?« auch im sozialen Umfeld schon gestellt hat, wenn das Paar dieses informiert hat (vgl. hierzu unsere Ausführungen zum Umgang mit dem sozialen Umfeld im Abschnitt über den Umgang mit Paaren noch vor der reproduktionsmedizinischen Behandlung). Es ist sehr wichtig, dass sich der Therapeut nicht in die Reihe der »Wie lange wollt ihr noch weiter leiden?«-Frager einreiht, da dies vom Paar einerseits als sehr verletzend erlebt werden kann und andererseits ein solches »Pushen« dem Therapeuten in keiner Situation zusteht – es geht nicht um seine Lebensplanung, sondern die des Paares. Wir halten deshalb auch in dieser Phase nach einer bereits längeren reproduktionsmedizinischen Behandlung therapeutische Offenheit und Zurückhaltung in der Festlegung für zentral. Doch diese Position ist nicht unwidersprochen – van der Broeck et al. (2010) weisen darauf hin, dass es für die Beratung wichtig ist, darauf hinzuwirken, dass ein Paar nicht »im Tunnel« stecken bleibt und deshalb so früh wie möglich die Pläne B und C mit ins Spiel zu bringen. Wir teilen die prinzipielle Idee, dass ein Paar so früh wie möglich über Alternativen nachdenken sollte. Das kritische Wort ist hier aber »wie möglich«. Wenn ein Paar noch nicht so weit ist, sich mit Plan B zu beschäftigen, dann wird es auf therapeutische Versuche, diesen zum Thema zu machen, mit Kränkung und Widerstand reagieren. Deshalb vertreten wir die Perspektive, dass auch in dieser Phase das Paar der Schrittmacher der Therapie sein muss und der Therapeut sich davon zurückhalten sollte, Druck auszuüben. Er kann nach dem Thema »fischen«, sollte es aber nicht einfordern.
Paare nach dem Beenden reproduktionsmedizinischer Bemühungen
Wenn Paare nach einem meist langen Leidensweg beschließen, reproduktionsmedizinische Bemühungen aufzugeben, fallen sie häufig erst einmal in ein tiefes Loch. Ein Lebenstraum muss begraben werden, der in seiner existenziellen Tragweite kaum groß genug beschrieben werden kann. Nach unserer Erfahrung sind es insbesondere die Frauen, für die das Aufgeben der Hoffnung auf ein eigenes Kind regelrecht traumatisierend sein kann. Nicht selten erleiden die Frauen einen schweren Stimmungseinbruch bis hin zu einer depressiven Krise. Doch selbstverständlich leiden auch Männer darunter, ihre etablierte Lebensperspektive begraben und sich neu aufstellen zu müssen. Der Paartherapeut hat die diffizile Aufgabe, beiden Partnern gerecht zu werden. Der Schwere der Konsequenzen entsprechend ist stark davon abzuraten, ein Paar nach der Entscheidung, die medizinische Behandlung abzubrechen, gleich zu alternativen Plänen zu befragen. Eine begrabene Hoffnung geht erst einmal mit Trauer einher, und dieser Trauer sollte Raum gewährt werden. Der Therapeut kann diesen Trauerprozess unterstützen, indem er dem Paar einen Raum zum Ausdruck der eigenen Gefühle und der erlebten Konsequenzen anbietet. Wenn das Paar auf diese Weise begleitet wird, dann werden sich dabei quasi von selbst Betrachtungen der zukünftigen Lebensplanung, der veränderten Wertewelt usw. ergeben. Das heißt, nach und nach wird der Weg frei werden, sich konkreter an »Plan B« heranzuarbeiten. Auch hierin benötigen Paare Unterstützung, da teilweise ähnlich wie bei der Reproduktionsmedizin möglicherweise wieder eine Mischung aus psychosozialer Belastung und organisatorisch-rechtlicher Verwirrung auf das Paar zukommt –eine Adoption als eine Variante von Plan B läuft auf einen längeren Prozess hinaus, in dessen Verlauf es viele Hürden zu nehmen und Fragen zu klären gibt. Auch andere Alternativen wie z. B. ein ehrenamtliches Engagement in der Betreuung von Flüchtlingskindern sowie andere Möglichkeiten, den Kontakt mit Kindern in das eigene Leben hineinzunehmen, auch wenn man keine eigenen Kinder zeugen kann, ziehen eine lange Reihe persönlicher und organisatorischer Konsequenzen nach sich. Und schließlich gibt es noch die Option, das weitere Leben ohne Kinder zu planen und somit völlig abseits davon in die Lebenszielklärung einzusteigen. Therapeuten können ein Paar in allen Stufen und bei all diesen Optionen wirksam unterstützen, wenn sie ihnen wiederum einen vorurteilsfreien und nicht festgelegten Untersuchungsraum anbieten, in dem die Paare sich ausdrücken und sortieren können. Da die Behandlung damit mehr und mehr einen Charakter annimmt, der nicht mehr zentral mit dem unerfüllten Kinderwunsch zu tun hat, sondern stattdessen eher allgemeinen Fragen der Lebensplanung ähnelt, schließen wir unsere Ausführungen an dieser Stelle.
Fazit
Die Frage, ob man Kinder in die Welt setzen möchte, gehört ohne Zweifel zu den grundsätzlichsten und existenziell tiefsten Fragen der eigenen Lebensplanung. Da die Kinderfrage letztlich mit jedem anderen wesentlichen Lebensthema in Berührung ist, wurde in diesem Kapitel deutlich, dass Therapeuten, die mit Kinderwunsch-Paaren arbeiten, einen extrem weiten Horizont an Themen überblicken und in ihrer Arbeit mit den Paaren zulassen müssen. Auf manche Probleme sind wir gar nicht detaillierter eingegangen, weil sie einerseits zwar im Umfeld des Kinderwunsches relevant sind, andererseits aber nicht mehr spezifisch mit dem Leiden am unerfüllten Kinderwunsch zu tun haben (z. B. die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsgeburt bei Teilnahme an reproduktionsmedizinischen Maßnahmen). Wir hoffen jedoch, eine Basis dafür vermittelt zu haben, in welchem Geist die Arbeit mit Kinderwunsch-Paaren erfolgen sollte: sehr offen, nicht festgelegt, empathisch, rücksichtsvoll und nicht fordernd. Wenn diese Grundgedanken angekommen und anhand der hier illustrierten Beispiele transparent geworden sind, dann sollte auch ihre Anwendung auf Fragen gelingen, die sich mit Kinderwunschpaaren stellen können und die hier nicht explizit besprochen wurden.
Dos
- Krisenhaftigkeit des Erlebens validieren (»Es ist total verständlich, dass es Ihnen so schlecht geht. Der Wunsch nach einem Kind steckt unglaublich tief in einem drin, und hier vom Schicksal so wie Sie geprüft zu werden, ist extrem hart.«)
- Tempo des Paares mitgehen (»Wir gehen hier genauso schnell oder langsam vor wie Sie das möchten, und wir sprechen über die Dinge, die Ihnen wichtig sind. Sie bestimmen, womit wir uns befassen.«)
- Selbstkontrolle fördern wo möglich (»Paare in Kinderwunsch-Behandlung haben häufig den Eindruck, dass sie den Ereignissen nur hilflos beiwohnen können und ›mitmachen‹ müssen. Die meisten Menschen leiden aber unter einer solchen Situation des Kontrollverlusts. Wenn es Ihnen auch so geht, dann wäre es günstig, wenn wir nach Möglichkeiten Ausschau halten, wie Sie wieder wenigstens so viel Kontrolle wie möglich über Ihr Leben bekommen können.«)
- Umgang mit dem Sozialraum klären (»Wem in Ihrem Umfeld möchten Sie was erzählen? Und welche Konsequenzen verbinden Sie damit?«)
Don’ts
- Voreilig nach »Plan B« fragen (»Sie machen das ja nun schon eine ganze Weile mit. Haben Sie sich auch schon Plan B zurechtgelegt, wenn das mit dem Kind nichts wird?«)
- Den Mann vergessen (»Ja, für Frauen ist es einfach schrecklich, wenn sie kein Kind bekommen können. Nichts gegen Sie, Herr Müller, aber für Frauen ist das einfach eine ganz andere Größenordnung.«)
- Gegen die Ärzte wettern (»Ja, die Ärzte sind leider völlig ahnungslos, was den Umgang mit Menschen angeht. Da ist jede Hoffnung vergebens. Schauen Sie, dass Sie mit allen Fragen zu mir kommen und den Arzt möglichst nur für die Untersuchungen und Behandlungen aufsuchen. Dann wird es Ihnen am besten gehen.«)
- Geschlechterunterschiede in der Verarbeitung ignorieren (Frauen brauchen häufig eher emotionalen Rückhalt, Männer eher Informationen; beides sollte »bedient« werden)
Literatur
Van den Broeck, U., Emery, M., Wischmann, T. & Thorn, P. (2010). Counselling in infertility: Individual, couple and group interventions. Patient Education and Counseling, 81 (3), 422–428.
Wischmann, T. & Stammer, H. (2010). Der Traum vom eigenen Kind. Psychologische Hilfen bei unerfülltem Kinderwunsch (4. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
Leseprobe aus: Frank-Noyon Noyon (2016) Schwierige Situationen in der Arbeit mit Paaren. Weinheim: Beltz.
Exklusiver Live-Workshop
Erleben Sie die Autorin unserer Leseprobe, Dr. Eva Frank-Noyon, am 10. Juli, 16:00 bis 20:30 Uhr, in einem exklusiven Online-Workshop zum Thema »Der Blick auf die Partnerschaft in Paar- und Einzeltherapie« im Rahmen unserer akkreditierten Webinar-Reihe!