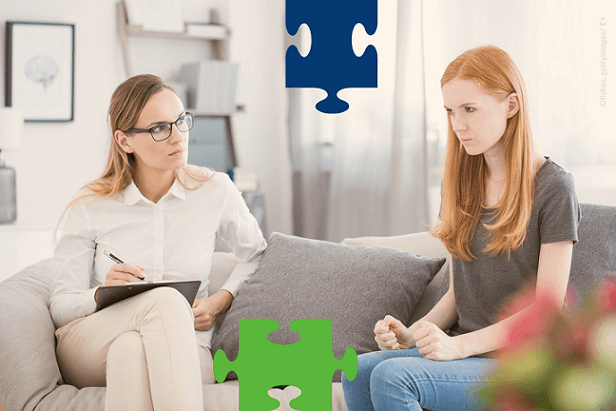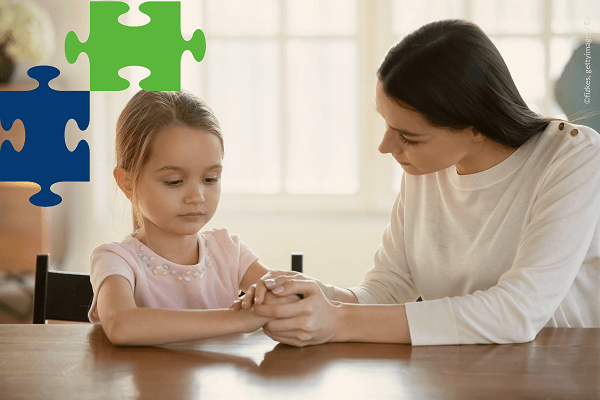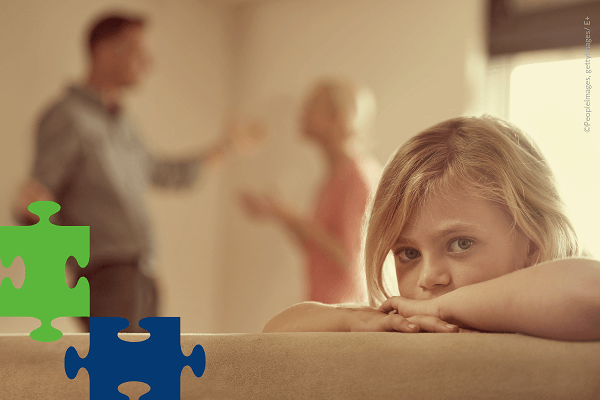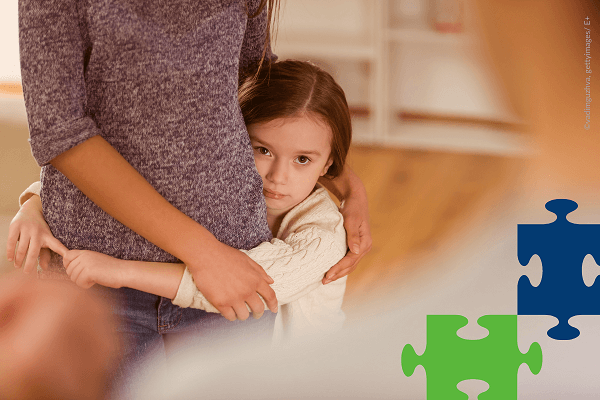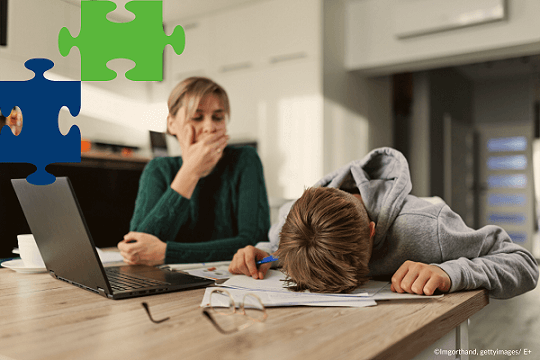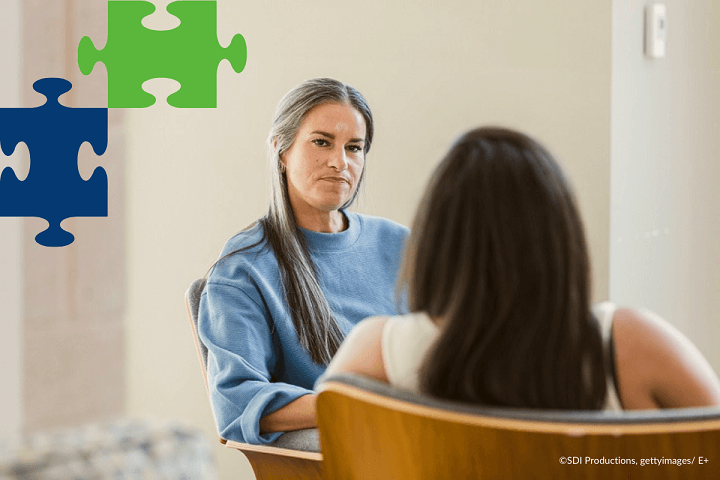Wenn der Psychotherapeutische Prozess sich dem Ende neigt, dann wird vor allem auch das Thema Abschied unumgänglich. Wie kann der Abschluss einer Psychotherapie auch mit Kindern und Teenagern, die trotz überwundenen Anliegen sehr an Ihnen hängen, gelingen? Wie kann der Übergang so gestaltet werden, dass sich die jungen Patient:innen nicht allein gelassen fühlen? Das lesen Sie in diesem Beitrag unserer Reihe »Schwierige Therapiesituationen in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie«.
Der Tod und das Sterben sind ein Teil des Lebens. So steht man auch als Therapeut:in vor der Aufgabe, seine Patient:innen beim Umgang damit zu begleiten. Dabei kann es die eigene Sterblichkeit sein, mit der sie konfrontiert werden oder auch der Tod einer nahestehenden Person. Alexander Noyon zeigt an zwei Fallbeispielen auf, wie eine einfühlsame Begleitung durch Psychotherapeut:innen aussehen kann, um die Patient:innen in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen.
Änderungsmotivation – also nicht nur das Bewusstsein für ein Problem, sondern der konkrete Wunsch nach Veränderung und auch die Bereitschaft, etwas dafür zu tun – ist eine der Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Verlauf der Psychotherapie. Dennoch: Wenn konkrete Veränderungen anstehen, haben Patient:innen häufig Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Katrin Hötzel zeigt, dass hier sensible Gesprächsführung nötig ist und stellt drei konkrete Interventionen vor, mit denen Sie Ihre Patient:innen im Entscheidungsprozess unterstützen können.
Von offen feindseligem Verhalten bis zu unkontrolliert affektiven Durchbrüchen: Aggressives Verhalten bei Kindern und Jugendlichen kann in diversen Formen auftreten und hat meist mindestens so diverse Ursachen. Alle aggressiven Problematiken beinhalten aber die Gefahr, dass sie sich wie in einem Teufelskreis immer mehr ausbreiten – und auf andere oder gar alle Lebensbereiche generalisieren. Die psychotherapeutische Behandlung erfordert neben der differenzierten Diagnose nicht zuletzt Realitätssinn und das Akzeptieren von Grenzen.
Kinder, die vernachlässigt sind und temporär oder dauerhaft von ihren Eltern getrennt werden, kennen oft nur desolate Bindungs- und Beziehungsgefüge. Es ist dann nicht selten, dass sie ihr Bindungsbedürfnis auf Beratungs- und Betreuungspersonen übertragen – oder auf ihre Therapeut:innen. Um das zu vermeiden und nicht erneut das Bindungsbedürfnis der Kinder zu verletzen, ist es zentral, dass Therapeut:innen Beziehungsangebote schaffen, die transparent sind und engere Bindungen fördern, ohne dass Sie dabei zu »neuen Eltern« werden.
Wenn Psychotherapie fruchtet, kann sie zu tiefgreifenden positiven Veränderungen im Leben der Klient:innen führen. Aber wovon hängt es ab, ob eine Therapie »erfolgreich« verläuft? Und was kann überhaupt als Behandlungserfolg verstanden werden? Wieso es sich lohnt, den Therapieprozess zu reflektieren und alternative Beratungsangebote auszuloten, lesen Sie im Beitrag unserer Autorin Ruth Kohlhas.
Aufgeladene Stimmung oder gar offener Streit, Auseinandersetzungen über Umgangsrechte und Kinder in Loyalitätskonflikten – hochstrittige Elternschaft ist für Kinder enorm belastend. Da stehen Kinder- und Jugendlichentherapeut:innen vor der Herausforderung, den Eltern Verständnis zu zeigen, aber vor allem das Wohl der Kinder im Blick zu behalten. Wie das gelingen kann und Sie Familien in solch schweren Situationen begleiten können, lesen Sie im dritten Beitrag unserer Reihe »Schwierige Therapiesituationen in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie«.
Die meisten Kinder kommen gemeinsam mit ihren Eltern in die Psychotherapie. Und wollen diese dann an ihrer Seite wissen, zeigen ängstliches und anhängliches Verhalten. Wenn das anhält und die Kinder nicht ohne die Eltern in die Therapie gehen wollen, kann das zur Herausforderung für die Therapeut:innen werden. Wie die Therapie ohne Eltern möglich wird und so die Beziehung zum Kind gestärkt werden kann, lesen Sie im zweiten Beitrag unserer Reihe »Schwierige Therapiesituationen in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie«.
»Mein Kind ist ganz normal, die anderen Kinder sind doch genauso!« oder »So ist mein Kind nicht. Die übertreiben doch alle maßlos!«: Solche Aussagen von Eltern können aus unterschiedlichen Motivationen heraus getätigt werden. In der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie können Verharmlosungen und Bagatellisierungen zu echten Herausforderungen werden. Wie der therapeutische Umgang mit ihnen gelingen kann und welche Dos und Don’ts helfen können, lesen Sie im ersten Beitrag unserer neuen Reihe ›Schwierige Situationen in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie‹.
Nicht jede Therapie verläuft erfolgreich. Manchmal stockt die Interaktion nicht nur, sondern die therapeutische Arbeit fruchtet überhaupt nicht. Wann und wie können Sie erkennen, ob das der Fall ist, es sich nicht nur um eine temporäre Stagnation handelt, sondern ein:e Patient:in gar nicht auf die Therapie anspricht? Und was ist dann zu tun?
»Meine frühere Therapeutin hat häufig nach meinen Träumen gefragt. Interessiert Sie das überhaupt nicht?« Wie reagieren Sie, wenn die Patient:innen aus früherer Therapie eine gegensätzliche Therapieform oder Vorgehensweise gewohnt waren und Ihre nun damit vergleichen? Vielleicht denken Sie sich: »Wenn Sie die Therapieform so viel besser finden, warum sind Sie dann zu mir gekommen?« Um eine zu persönliche Einordnung zu vermeiden, zeigen unsere Autoren Beispiele für mögliche Formulierungen und bieten weitere Dos und Don‘ts für einen professionellen Umgang.
Therapeut:innen verstehen ohne zu urteilen. Sie hören ihren Patient:innen zu und stehen ihnen in schwierigen Lebensphasen zur Seite. Diese wertvolle therapeutische Beziehung, die oft von nicht gewohnter Akzeptanz und Verständnis geprägt ist, führt nicht selten dazu, dass sich Patient:innen in ihre Therapeut:innen verlieben. Der vierte Beitrag unserer Reihe »Schwierige Therapiesituationen« handelt davon, was passiert, wenn die Gefühle von Patient:innen Überhand nehmen, wie die professionelle Antwort darauf aussehen kann und wie die therapeutische Arbeit dennoch gelingt.