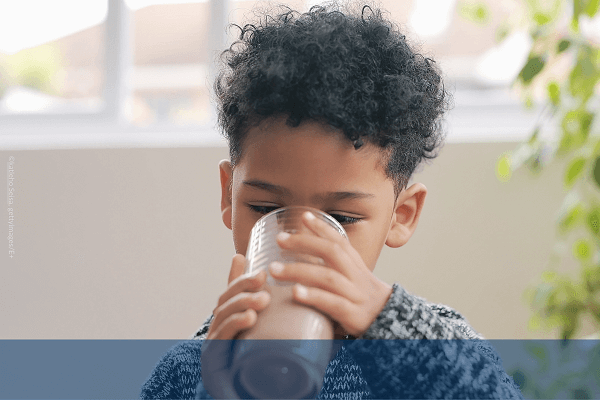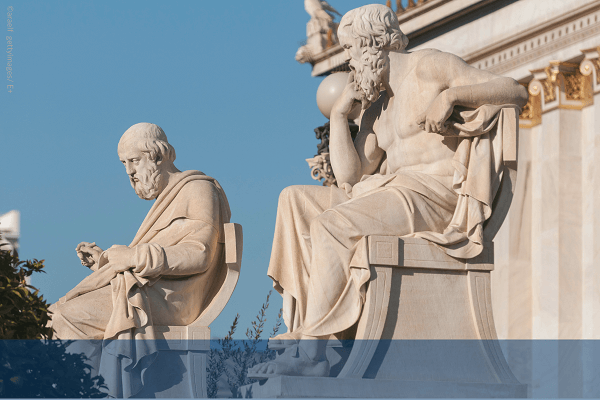Achtsamkeitsübungen mit Kindern – ist das sinnvoll? Welchen Nutzen hat die Achtsamkeitspraxis bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen und wie lassen sich Übungen in die Psychotherapie integrieren? Lesen Sie, wieso Momente des Innehaltens und bedachten im-Moment-Seins auch Kindern guttun und wie Sie durch gemeinsames Kakaotrinken die Achtsamkeit der Kleinen stärken.
Selbsterfahrung ist weit mehr als nur ein verpflichtender Bestandteil der therapeutischen Ausbildung – sie ist der Schlüssel zur Entwicklung einer therapeutischen Identität. In unserem Interview mit der erfahrenen Selbsterfahrungsleiterin Ulrike Juchmann erfahren Sie, wie dieser intensive Prozess angehende Psychotherapeut:innen prägt, welche persönlichen und professionellen Kompetenzen dabei gestärkt werden und warum Selbsterfahrung für die eigene Gesundheit und das Vertrauen in die therapeutischen Fähigkeiten so essenziell ist.
Wenn Kinder in therapeutischer Behandlung sind, kann es für ihre Eltern schwierig sein, nicht direkt teilhaben zu können: Was genau passiert hinter den geschlossenen Türen des Therapieraums? Worüber sprechen Therapeut:in und Kind? Dieses Bedürfnis der Eltern nach Information kann wiederum die Behandler:innen herausfordern: Wie viel darf preisgegeben werden, wo liegen die Grenzen der Schweigepflicht? Wie kann das Vertrauensverhältnis mit den jungen Patient:innen UND Eltern bestehen? Wie in beide Richtungen Transparenz geschaffen werden?
Wie reagieren Sie, wenn Ihre Patientin bei jeder Frage z.B. in stilles Schluchzen oder sogar dramatisches Weinen ausbricht? Wie gehen Sie damit um, wenn der Bewältigungsmodus die Schematherapie unmöglich zu machen scheint?
Wann eine schnelle empathische Konfrontation zentral ist und welche weiteren Techniken der Schematherapie in solchen Situationen hilfreich sein können, erfahren Sie in dieser Leseprobe unserer neuen Reihe »Schwierige Situationen in der Schematherapie«.
Wann eine schnelle empathische Konfrontation zentral ist und welche weiteren Techniken der Schematherapie in solchen Situationen hilfreich sein können, erfahren Sie in dieser Leseprobe unserer neuen Reihe »Schwierige Situationen in der Schematherapie«.
In der psychotherapeutischen Arbeit mit trans* Personen können sensible Themen zur Sprache kommen, mit denen Psychotherapeut:innen sonst wenig Berührungspunkte haben. Neben Coming-out und Transition können das beispielsweise Entscheidungsprozesse zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen und nicht zuletzt Diskriminierungserfahrungen sein. Welche Themen darüber hinaus relevant sein können, welcher Leidensdruck bei trans* Personen entstehen kann und welche Begleiterscheinungen damit einher gehen können, lesen Sie im Interview mit Falk Peter Scholz.
Viele Dilemma-Situationen in der Therapie sind durch Schuldgefühle geprägt, die den Fortschritt hemmen. Dabei entsteht Schuld durch das Abgleichen mit eigenen Werten und ist mit Bewertungen verknüpft. Kognitive Techniken bieten dabei nur teilweise Entlastung. Emotionsfokussierte Ansätze hingegen ermöglichen eine tiefere Bearbeitung und Wahrnehmung der zugrunde liegenden Emotionen. Wie geht man also vor, wenn Patient:innen starke Schuldgefühle erleben? Unsere Autorin stellt fünf effektive emotionsfokussierte Techniken und ihre Besonderheiten in der Arbeit mit Schuldgefühlen vor.
Wie die Kognitive Verhaltenstherapie arbeitet auch die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) mit schwierigen Gedanken wie »Ich bin nichts wert« oder »Meine Zukunft ist verpfuscht«, geht aber einen anderen Weg und versucht nicht, diese Gedanken zu ändern. Stattdessen hilft die ACT den Patient:innen, ihr Handeln nach ihren persönlichen Werten auszurichten. Im Blogbeitrag erfahren Sie, was mit »Defusion« gemeint ist und wie Sie Ihren Patient:innen helfen können, lähmende Gedanken zu überwinden. Außerdem erfahren Sie, wieso der Autor dieser Zeilen womöglich demnächst ein gutes Alibi braucht.
Angst ist ein wichtiges Gefühl und ein gesunder Umgang mit ihr grundlegend für das ganze Leben. Wenn schon im jungen Alter ein problematisches Verhältnis zu ihr besteht und eine Angststörung vorliegt, lässt sich dem therapeutisch wirksam begegnen: Expositionsübungen können hier der Schlüssel zur Angstbehandlung sein. Kinder und Jugendliche können dann neue Erfahrungen sammeln und lernen, dass ihre Befürchtungen nicht eintreten. Lesen Sie, welche therapeutischen Interventionen und Übungen den jungen Patient:innen helfen, ihre Ängste zu bewältigen.
Bereits Kleinkinder müssen für sie herausfordernde soziale Interaktionen navigieren, sich mit anderen Kindern auseinandersetzen oder gar Konflikte lösen. Wenn die Austragung dieser körperlich wird und Kinder aufeinander losgehen, gibt es Handlungsbedarf. Viele Eltern neigen in solchen Situationen dazu, mit Strafen zu reagieren, statt sich empathisch zu verhalten. Dabei werden affektive und kognitive Empathie am besten zu Hause trainiert.
Schwierige Gefühle und herausfordernde Situationen: Stellen Sie sich diesen oder weichen Sie ihnen eher aus? Auch im therapeutischen Kontext kommt es immer wieder vor, dass Frust und Ärger aufkommen – auch aufseiten der Therapeut:innen. Eine Abwehrreaktion kann naheliegend sein, aber in allen Kontexten der therapeutischen Arbeit kann Akzeptanz helfen. Wieso das weniger ein Gefühl als vielmehr eine Haltung ist und wie Sie selbst als Therapeut:in sowie auch Ihre Klient:innen davon profitieren, lesen Sie im Beitrag.
Einige reagieren unmittelbar mit Kopfschmerzen, andere mit Magenbeschwerden, wieder andere spüren es hauptsächlich nachts, wenn sie sich schlaflos im Bett wälzen: Stress und Belastungen durch diesen können sich ganz unterschiedlich äußern. Auch Auslöser, die wahrgenommene Intensität und die Bewältigungsansätze variieren. Dennoch: zu viel und anhaltender Stress ist ungesund und kann krank machen. Wie Stressprävention zum Bestandteil des therapeutischen Repertoires wird und Sie Ihre Patient:innen unterstützen, ihre Resilienz auszubilden, lesen Sie im Beitrag.
So simpel wie genial – aber mintunter alles andere als einfach: Der Sokratische Dialog basiert auf der Idee, dass Patient:innen durch eine hinterfragende Gesprächsführung der Therapeut:innen Reflexion und Selbsterkenntnis erfahren. Was das mit dem Vorgehen einer Hebamme zu tun hat, lesen Sie im Interview mit Prof. Dr. Norbert Lotz.